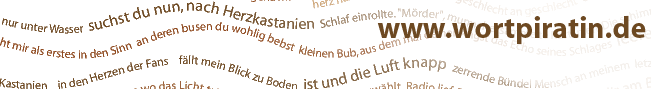Geneigte Leserschaft,
mein kleines, feines Blog ist umgezogen und findet sich nun hier. Als Archiv und weil im Internet nicht viel ärgerlicher ist als Links, die einen ins Nirwana schicken, bleibt auch diese Seite bestehen. Künftig weiter geht es nun aber an anderer Stelle und im neuen Gewand: Bitte folgen Sie mir unauffällig.
Danke, bitte, setzen,
Mara Braun
PS: Außerdem zu finden bin ich auf Facebook und Twitter sowie bald auf meiner neuen Homepage. Spannung!
*
Mittwoch, 12. Februar 2014
Montag, 27. Januar 2014
Am Ende ein Sonntagskind
Mein Vater wuchs im festen Glauben
daran auf, ein Sonntagskind zu sein. Ich kann nicht sagen, warum ihm das so
wichtig war – aber ich erinnere mich, dass er oft davon sprach: Meine Oma hatte
ihn an einem Sonntag auf die Welt gebracht, damals, ein paar Jahre vor
Kriegsbeginn. Und das, davon schien er aus vollem Herzen überzeugt, hatte sein
Gemüt geprägt, seinen Glücksstern bestimmt.
Am 50. Geburtstag meines Vaters
aber kam es bei den Festlichkeiten zu einem Eklat, der meine Oma als Lügnerin
enttarnte. Zum runden Jubiläum hatte meine Tante sich ein ganz besonders
Geschenk für ihren jüngeren Bruder einfallen lassen: die Ausgabe einer Berliner
Tageszeitung, vom Tag seiner Geburt. Mein Vater war begeistert, meine Großmutter
wirkte hingegen seltsam angespannt. Und bald zeigte sich auch warum – der
Wochentag, der mit fetten Lettern auf der Zeitung prangte, war kein Sonn-
sondern ein Montag.
 |
| Stein des Anstosses: Berliner Lokal-Anzeiger. (Foto: WP) |
Mein Vater war ein sehr
leidenschaftlicher Mann, das galt auch für seine Wut – und er wurde schrecklich
wütend. Auf seine Mutter, die ihn belogen hatte. Auf seine Schwester, die ihm
die Lüge aufgedeckt hatte, wenngleich unbeabsichtigt. Darauf, dass er
ausgerechnet montags auf die Welt gekommen war, als würde mit diesem Wochentag
etwas nicht stimmen. Auch meine Großmutter, eine kleine, energische Person,
wurde wütend – auf meine Tante, natürlich, die doch nur das Beste im Sinn
gehabt hatte. Und redete sich erbost raus, die zwei Minuten nach Mitternacht
könne man getrost vernachlässigen.
Aber mein Vater blieb
unversöhnlich. Denn es hatte ihm immer etwas bedeutet, diese Rolle des
Sonntagskindes. Er hatte sein Leben darauf bezogen und jedes Glück, das ihm in
all der Zeit widerfahren war. Nun fühlte er sich betrogen.
Bereits ein paar Jahre zuvor hatte
mein Paps, noch sehr jung, den ersten Herzinfarkt erlitten, dem über die Jahre
viele weitere Herzsorgen folgen sollten. Die Ärzte hatten meiner Mutter damals
kaum Hoffnung auf sein Überleben gemacht; wir Kinder waren viel zu klein, um zu
verstehen, was da passierte. Nur erschrocken, dass unser Vater plötzlich im
Krankenhaus lag und dazu noch einen Rollstuhl brauchte, obwohl man uns doch
erklärt hatte, sein Herz wäre krank. Aber das steckte doch nicht in seinen
Füßen!
Mein Vater überlebte, fast schon
zur Verwunderung seiner Ärzte. Die ihm gratulierten, als er verkündete, dies
hier sei ab heute sein zweiter Geburtstag, weil ihm das Leben neu geschenkt
worden war. Diesmal ist es ein Sonntag gewesen, tatsächlich, als er die OP
überlebte und sich wieder einließ auf das Leben; doch noch ein Sonntagskind
wurde, im zweiten Anlauf. Es war nur das erste von vielen Überlebensmomenten,
die ihm und uns beschieden wurden; doch der letzte Infarkt hat sein schwach
gewordenes Herz tödlich getroffen. Uns hat er überwältigt und die Sprache
geraubt, weil wir so gewohnt waren, an sein Überleben.
Am Tag seines Todes saßen wir vier
Kinder bei meiner jüngsten Schwester zusammen und beratschlagten, was nun zu
tun sei. Weil dies doch alles war, das uns blieb – nun, da er von uns gegangen
war: beratschlagen, entscheiden und Dinge erledigen, in seinem Namen. Als aber
schließlich einer von uns damit anfangen wollte, notwendige Telefonate zu
führen, da schüttelte mein Schwager den Kopf; und wir begriffen, noch bevor die
Worte seinen Mund verließen, was er sagen wollte: „Geht nicht. Heute ist
Sonntag.“
*
Labels:
Familienbande,
Peter Pan
Montag, 20. Januar 2014
Klickstatistik – Das war 2013
Das Jahr 2013 liegt bereits wieder einige Wochen zurück, höchste Zeit also, um einen kurzen Blick zu werfen auf die Blogstatistik, die es mit sich gebracht hat. Richtig etwas los war hier erst ab etwa Mitte des Jahres, was primär daran liegt, dass ich vorher kaum neue Texte veröffentlicht habe. Gerade bevor »111 Gründe, Mainz 05 zu lieben«, in die Läden gekommen ist, wurde viel geklickt – auch seither lässt sich eine eindeutige Tendenz zu den Fußballtexten ausmachen. Und so ist es denn auch nicht weiter verwunderlich, dass sämtliche Texte aus den Top 5 des vergangenen Jahres Mainz 05 oder unser Buch über den Verein zum Thema haben.
1. Der dümmste Fangesang der Welt (klick!) *1802 Visits
2. Und die Tränen vergehen im Regen (klick!) *1257 Visits
3. Dollbohrer-Alarm, oder: Elkin ist schuld (klick!) *489
4. We’ve got the Book (klick!) *406 Visits
5. Die Leiden der tapferen Fans (klick!) *352 Visits
So lautet die Blogspot-interne Statistik; die ist zumeist wenigstens zeitnah relativ zuverlässig. Liegt die Veröffentlichung eines Textes bereits länger in der Vergangenheit, kommt es allerdings auch vor, dass plötzlich alle bisherigen Visits verschwunden sind und die Zählung von neuem beginnt. Ebenfalls ihre Tücken hat die Einbindung des Facebook-Plugins, sowohl Likes als auch Kommentare verschwinden nach kurzer Zeit schon mal ins Nirgendwo.
Für das noch junge Jahr 2014 ist der Klicksieger eventuell bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gefunden – ob die Odenwaldtapete mit ihren 2162 Visits (Tendenz weiterhin steigend) noch überholt wird, bleibt abzuwarten.
*
 |
| Die Klicksieger tragen alle Stollenschuhe. (Foto: S. Hofschlager /pixelio) |
2. Und die Tränen vergehen im Regen (klick!) *1257 Visits
3. Dollbohrer-Alarm, oder: Elkin ist schuld (klick!) *489
4. We’ve got the Book (klick!) *406 Visits
5. Die Leiden der tapferen Fans (klick!) *352 Visits
So lautet die Blogspot-interne Statistik; die ist zumeist wenigstens zeitnah relativ zuverlässig. Liegt die Veröffentlichung eines Textes bereits länger in der Vergangenheit, kommt es allerdings auch vor, dass plötzlich alle bisherigen Visits verschwunden sind und die Zählung von neuem beginnt. Ebenfalls ihre Tücken hat die Einbindung des Facebook-Plugins, sowohl Likes als auch Kommentare verschwinden nach kurzer Zeit schon mal ins Nirgendwo.
Für das noch junge Jahr 2014 ist der Klicksieger eventuell bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gefunden – ob die Odenwaldtapete mit ihren 2162 Visits (Tendenz weiterhin steigend) noch überholt wird, bleibt abzuwarten.
*
Labels:
Hausmitteilung,
Mainz 05
Donnerstag, 16. Januar 2014
Inside Llewyn Davis – Home Is Where The Music Is
Angelehnt ist die Geschichte des neuen Films der Coen Brüder
an die posthum erschienene Autobiografie des Musikers Dave van Ronk. Eigentlich
aber geht es „Inside Llewyn Davis“ nicht um die Geschichte einer einzelnen
Person, das machen schon die ersten Bilder dieses Filmes klar. Ein Mikrofon ist
da zu sehen, umspielt vom Bühnenlicht des „Gaslight Café“ in Greenwich Village,
zart umtanzt vom Staub, der dort ansetzt, während jeden Abend mehr oder weniger
erfolgreiche Künstler versuchen, bei ihren Auftritten irgendjemanden auf sich
aufmerksam zu machen, der ihnen einen Vertrag geben wird, von dem sie künftig
die Miete zahlen können. Um diese Musiker, mehr noch: eben ihre Musik geht es
eigentlich; und auch das ist erst die halbe Wahrheit.
 |
| Music was my first love... |
Besondere Glücksmomente hat das Leben für Llewyn Davis
(grandios: Oscar Isaac) derzeit nicht im Programm. Der Musiker ist so
abgebrannt, dass es ihm am Mindesten mangelt – einem Mantel gegen die
winterliche Kälte und einem Dach über dem Kopf. Und so, wie er tagsüber
zwischen Bar, Produzent und (an guten Tagen) dem Aufnahmestudio hin und her
tingelt, macht er sich jeden Abend auf die Suche nach einer Couch, auf der er
diese Nacht verbringen kann – und mit etwas Glück vielleicht noch eine zweite.
Womit spielerisch das zweite große Thema des Films etabliert ist, denn er
handelt auch davon, unterwegs zu sein, jedoch nicht freiwillig, sondern weil
ein fester Ort fehlt, an den man zurückkehren kann.
Sein Partner, mit dem Llewyn einst die erste Platte
einspielte, hat sich das Leben genommen, der Vater lebt im Pflegeheim und seine
Schwester findet ihn und sein Künstlerdasein arrogant – spart aber ihrerseits
nicht mit Arroganz gegenüber dem Bruder. Davis ist mindestens müde, eher
ausgebrannt, er ist genervt und frustriert und im Leben völlig entwurzelt. All
das aber gerät in Vergessenheit, wenn er zur Gitarre greift – da ist sie
wieder, die Musik, die diesem Film ebenso Leben einhaucht wie seinem
Hauptdarsteller. In der er von eben diesem Leben und all seinen Widrigkeiten
erzählt, so berührend und intensiv, dass die Welt einen Moment lang inne hält,
weil nichts anderes zählt.
Es mag sonst nichts geben, womit dieser Llewyn Davis sich im
Leben sicher ist – von seiner Musik aber ist er vollkommen überzeugt. Man mag
es als Kurzsichtigkeit oder gar Arroganz verurteilen, wenn er das Angebot von
Musikproduzent Bud Grossmann (angelehnt an Albert Grossmann, herrlich
unterkühlt gespielt von Fahrid Murray Abraham) ablehnt, als Teil eines Trios zu
spielen, nachdem er diesen mit seinem Solovortrag nicht zu überzeugen
vermochte. Man kann es aber auch mutig nennen und konsequent, weil er sich das,
was ihm so unfassbar wichtig ist, nicht für Geld verbiegen lässt. Was ihn
allerdings nicht davor schützen wird, in einer der nächsten Nächte auf fremden
Sofas mit der traurigen Realität zu hadern, dass auch diese mutige Konsequenz
ihm leider seine Miete nicht zahlt.
 |
| Mutig, konsequent, aber ohne Dach über dem Kopf. |
Um vom Vorabend einer Zeit zu erzählen, in der Bob Dylan
sich bald anschicken würde, die Folkmusik von eben jenem Greenwich Village aus
auf ihre erfolgreiche Reise um die Welt zu schicken, picken sich Joel und Ethan
Coen einen jener Musiker, die es nicht geschafft haben – und das ist ein Glück.
Denn diese Zeit war voll von ihnen, so wie vermutlich jede Zeit voll ist von
Künstlern, die es verdient hätten, entdeckt zu werden, aber eben nie „zur
rechten Zeit am rechten Ort“ sind; was immer das auch heißen mag... Genau deren
Geschichten sind es aber, die zu erzählen es wert ist, in all ihrer
Menschlichkeit und Tragik, mit all dem Pech und den Schicksalsschlägen, kurzum
– den Realitäten dieses Lebens. Und die Brüder tun dies mit viel Liebe zum
Detail, nicht nur in Sachen Setting und Ausstattung, sondern auch bezüglich
ihrer Figuren, von denen einige angelehnt sind an solche, die in dieser Zeit
tatsächlich gelebt und eine Rolle gespielt haben. (Herausragend ist dabei unter
anderem John Goodman in seiner Rolle als draufgeschickter Jazzsänger, mit dem
sich Davis eine qualvolle Autofahrt lang den Wagen teilt und der sowohl durch
Dr. John als auch Doc Pomus inspiriert wurde.)
Oberflächlich gesehen erzählt „Inside Llewyn Davis“ die
Geschichte eines kontinuierlichen Scheiterns. Davis scheint bereits an einem
Tiefpunkt angekommen, als der Zuschauer ihm begegnet, aber egal, wie sehr er
sich im Folgenden abmüht, er scheint vom Pech verfolgt: Es läuft ihm einfach
alles schief. Da ist zum einen Jean, verheiratet mit seinem Kumpel Jim und
schwanger – vermutlich von Llewyn. Aus der vordergründig unangenehmen
Situation, sich von ihr wüst beschimpfen zu lassen, erwächst das Problem, für
den Eingriff zu bezahlen, bei dessen Vorgespräch er vom ausführenden Arzt
nebenbei auch noch erfährt, er ist Vater: Die Exfreundin hat das gemeinsame
Kind ohne sein Wissen in letzter Minute nicht abgetrieben, sondern zieht es bei ihren Eltern groß.
 |
| Is the cat your act? Did you bring your penis along, too? |
Dieses Wissen begleitet ihn ebenso durch den Film wie die
Katze der Gorfeins, bei denen er häufig übernachtet. Weil ihm das Tier aus der
Wohnung entwischt, deren Tür darauf prompt ins Schloss fällt, wird sie zu
seinem Begleiter; allerdings nur, bis sie ihm erneut durchbrennt – diesmal aus
dem Fenster der Wohnung von Jim und Jean. So selten der Glücksmoment, als er
sie am nächsten Tag im Village entdeckt, so schnell ist der denn auch wieder
entlarvt: Es ist die falsche Katze, die er den Gorfeins bringt; es folgt das
hysterische Ende eines Abends, der ohnehin bereits außer Kontrolle geraten war
– die „falsche Katze“ aber bleibt ihm erhalten.
Dank Jim hat Llewyn derweil einen Song mit eingespielt, der
bald hohe Tantiemen verspricht – blöd nur, dass er auf diese verzichtet hatte,
um sich das Geld direkt auszahlen zu lassen: für die Abtreibung. Erst scheint
es wie ein richtig schlechter Tag, an dem wir Llewyn erwischen, bald wird eine
ganze Woche daraus und ganz ehrlich, die Chancen, dass es für ihn demnächst
tatsächlich besser wird, stehen nicht besonders: Immer dann, wenn er glaubt,
nicht mehr tiefer fallen zu können, setzt es den nächsten Nackenschlag. Wie er
die allesamt erträgt, mag stoisch erscheinen, es liegt aber eine große Würde
darin, wie er sich auf den Beinen hält.
 |
| Entsättigte Farben und Liebe zum Detail. (Fotos: Verleih) |
Bleibt die Frage, warum man sich einen Film anschauen
sollte, in dem eine tragische Figur permanent auf die Fresse bekommt, letztlich
sogar im wörtlichen Sinne, und zwischendurch zweifelnd und hadernd durch ein in
entsättigten Farben eingefangenes, unfreundliches New York tapert, auf der
Suche nach einem kleinen bisschen Glück – und nach einem Hafen, der endlich
etwas wie Ankommen verspricht (es scheint kaum zufällig, dass Davis’ Brotjob
einst ausgerechnet der eines Matrosen der Handelsmarine war – gleichfalls ohne
feste Heimat auf dem Wasser unterwegs). Damit wären wir zurück bei der Musik,
einerseits, zum anderen aber bei den Coen-Brüdern. Es ist ihr Humor und es sind
die Songs dieser Zeit, die diesem Film so viel Hoffnung verleihen, dass es fast
absurd anmutet; Hoffnung vor allem, die weit über seine Geschichte hinaus geht.
Denn er erzählt, Absicht oder nicht, auch die Geschichte unserer Zeit, in der
Menschen entwurzelt sind und auf der Flucht, in der Leute abgehängt werden von
der Gesellschaft, in der sie leben und Kunst und Kultur an Stellenwert
verlieren.
Das ist die eigentliche Kunst der Brüder, sich derart
lakonisch und scheinbar belanglos mit den großen Themen unserer Zeit
auseinanderzusetzen, dass man sich tatsächlich unterhalten fühlt dabei – und
für einen Kinobesuch lang vergisst, die beiden tun beinahe nichts anderes, als
Realitäten abzubilden. Das aber mit einem verdammt guten Soundtrack.
Inside Llewyn Davis
Buch & Regie: Ethan und Joel Coen
Darsteller: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake,
John Goodman
USA, 105 Minuten, FSK 6
Trailer „Inside Llewyn Davis“: http://bit.ly/J6aJo9
The Gaslight Café on MacDougal Street: http://bit.ly/1d2iKpO
Dave van Ronk – „Hang me, oh hang me“: http://bit.ly/1iWk9C1
David Haglund: The People who inspired Llewyn Davis: http://slate.me/1clFIY7
*
Abonnieren
Posts (Atom)